In verschiedenen Kulturen geben 2 bis 10 % der Menschen an, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu haben. In den USA bezeichnen sich 1 % bis 2,2 % der Frauen bzw. Männer als homosexuell. Trotz dieser Zahlen halten viele Menschen homosexuelles Verhalten immer noch für eine anomale Entscheidung. Biologen haben jedoch homosexuelles Verhalten bei mehr als 450 Arten dokumentiert, was darauf hindeutet, dass gleichgeschlechtliches Verhalten keine unnatürliche Wahl ist, sondern in der Tat eine wichtige Rolle innerhalb von Populationen spielen kann.
In einer Ausgabe des Magazins Science aus dem Jahr 2019 beschreiben die Genetikerin Andrea Ganna vom Broad Institute des MIT und Harvard und ihre Kollegen die bisher größte Untersuchung von Genen, die mit gleichgeschlechtlichem Verhalten in Verbindung stehen. Durch die Analyse der DNA von fast einer halben Million Menschen aus den USA und Großbritannien kamen sie zu dem Schluss, dass Gene zwischen 8 und 25 % des gleichgeschlechtlichen Verhaltens ausmachen.
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Geschlecht nicht nur männlich oder weiblich ist. Vielmehr handelt es sich um ein Kontinuum, das sich aus der genetischen Veranlagung eines Menschen ergibt. Dennoch hält sich hartnäckig der Irrglaube, gleichgeschlechtliche Anziehung sei eine Entscheidung, die eine Verurteilung oder Bekehrung rechtfertigt und zu Diskriminierung und Verfolgung führt.
Ich bin Molekularbiologin und interessiere mich für diese neue Studie, da sie den genetischen Beitrag zum menschlichen Verhalten weiter beleuchtet. Als Autor des Buches „Pleased to Meet Me: Gene, Keime und die merkwürdigen Kräfte, die uns zu dem machen, was wir sind“ habe ich umfangreiche Forschungen zu den biologischen Kräften durchgeführt, die die menschliche Persönlichkeit und das Verhalten prägen, einschließlich der Faktoren, die die sexuelle Anziehung beeinflussen.
Die Jagd nach ’schwulen Genen‘
Das neue Ergebnis steht im Einklang mit mehreren früheren Studien an Zwillingen, die darauf hinweisen, dass gleichgeschlechtliche Anziehung ein vererbbares Merkmal ist.
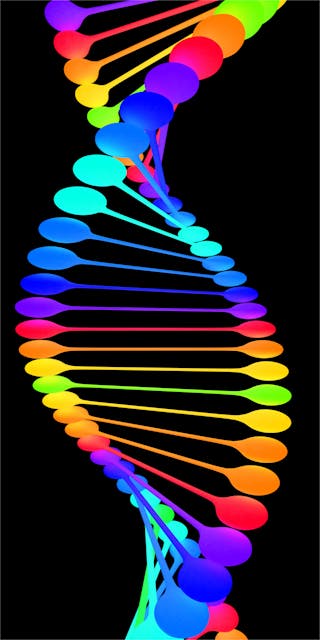
Die Studie aus dem Jahr 2019 ist die jüngste auf der Jagd nach „Schwulengenen“, die 1993 begann, als Dean Hamer männliche Homosexualität mit einem Abschnitt des X-Chromosoms in Verbindung brachte. Mit der zunehmenden Einfachheit und Erschwinglichkeit der Genomsequenzierung sind weitere Genkandidaten aufgetaucht, die möglicherweise mit homosexuellem Verhalten in Verbindung stehen. Sogenannte genomweite Assoziationsstudien identifizierten ein Gen namens SLITRK6, das in einer Gehirnregion namens Zwischenhirn aktiv ist, die sich in der Größe zwischen homo- und heterosexuellen Menschen unterscheidet.
Genetische Studien an Mäusen haben weitere Genkandidaten aufgedeckt, die die sexuelle Präferenz beeinflussen könnten. Eine Studie aus dem Jahr 2010 brachte die sexuelle Präferenz mit einem Gen namens Fucose-Mutarotase in Verbindung. Wurde das Gen bei weiblichen Mäusen ausgeschaltet, fühlten sie sich von weiblichen Gerüchen angezogen und zogen es vor, Weibchen zu besteigen, anstatt Männchen.
Andere Studien haben gezeigt, dass die Störung eines Gens namens TRPC2 dazu führen kann, dass sich weibliche Mäuse wie Männchen verhalten. Männliche Mäuse, denen TRPC2 fehlt, zeigen keine männlich-männliche Aggression mehr, und sie zeigen sexuelle Verhaltensweisen sowohl gegenüber Männchen als auch gegenüber Weibchen. TRPC2 ist im Gehirn für die Erkennung von Pheromonen zuständig, d. h. von chemischen Stoffen, die von einem Mitglied einer Spezies freigesetzt werden, um bei einem anderen eine Reaktion hervorzurufen.
Da mehrere Genkandidaten mit Homosexualität in Verbindung gebracht werden, schien es höchst unwahrscheinlich, dass es ein einziges „schwules“ Gen gibt. Dieser Gedanke wird durch die neue Studie weiter gestützt, in der fünf neue genetische Loci (feste Positionen auf Chromosomen) identifiziert wurden, die mit gleichgeschlechtlicher Aktivität korrelieren: zwei, die bei Männern und Frauen auftraten, zwei nur bei Männern und eines nur bei Frauen.
Wie könnten diese Gene gleichgeschlechtliches Verhalten beeinflussen?
Ich finde es faszinierend, dass einige der in Gannas Studie identifizierten Gene von Männern mit Geruchssystemen in Verbindung stehen, eine Erkenntnis, die Parallelen zu den Arbeiten bei Mäusen aufweist. Gannas Gruppe fand weitere Genvarianten, die möglicherweise mit der Regulierung von Sexualhormonen in Verbindung stehen, von denen andere Wissenschaftler bereits angedeutet haben, dass sie eine große Rolle bei der Gestaltung des Gehirns spielen, die das Sexualverhalten beeinflusst.

Männer mit einer genetischen Erkrankung namens Androgeninsensitivitätssyndrom können weibliche Genitalien entwickeln und werden in der Regel als Mädchen erzogen, obwohl sie genetisch gesehen männlich sind – mit einem X- und Y-Chromosom – und sich zu Männern hingezogen fühlen. Dies deutet darauf hin, dass Testosteron benötigt wird, um ein pränatales Gehirn zu „vermännlichen“; wenn das nicht geschieht, wächst das Kind mit dem Wunsch nach Männern auf.
Auch Mädchen, die an einer genetischen Störung namens kongenitale adrenale Hyperplasie leiden, sind im Mutterleib ungewöhnlich hohen Mengen an männlichen Hormonen wie Testosteron ausgesetzt, was ihr Gehirn vermännlichen und die Wahrscheinlichkeit von Lesbentum erhöhen kann.
Es ist auch möglich, dass Hormonveränderungen während der Schwangerschaft die Konfiguration des Gehirns des Fötus beeinflussen können. Bei Ratten führt die Manipulation von Hormonen während der Schwangerschaft zu Nachkommen, die homosexuelles Verhalten zeigen.
Warum gibt es homosexuelles Verhalten?
Es gibt verschiedene Hypothesen, die erklären sollen, wie Homosexualität bei der Weitergabe von Familiengenen von Vorteil sein kann. Eine dieser Hypothesen beruht auf dem Konzept der Verwandtenselektion, bei dem die Menschen darauf hinarbeiten, die Gene ihrer Familie an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Homosexuelle Onkel und Tanten sind zum Beispiel „Helfer im Nest“, die dabei helfen, die Kinder anderer Familienmitglieder aufzuziehen, um den Stammbaum zu erhalten.
Eine andere Idee besagt, dass Homosexualität ein „Kompromissmerkmal“ ist. So tragen beispielsweise bestimmte Gene bei Frauen dazu bei, ihre Fruchtbarkeit zu erhöhen, aber wenn diese Gene bei einem Mann exprimiert werden, prädisponieren sie ihn zur Homosexualität.
Sexuelles Verhalten ist sehr vielfältig und wird im gesamten Tierreich durch ausgeklügelte Mechanismen gesteuert. Wie bei anderen komplexen Verhaltensweisen ist es nicht möglich, Sexualität vorherzusagen, indem man wie in einer Kristallkugel in eine DNA-Sequenz blickt. Solche Verhaltensweisen ergeben sich aus Konstellationen von Hunderten, vielleicht Tausenden von Genen und der Art und Weise, wie sie von der Umwelt reguliert werden.
Es gibt zwar kein einzelnes „Schwulen-Gen“, aber es gibt überwältigende Beweise für eine biologische Grundlage für die sexuelle Orientierung, die vor der Geburt aufgrund einer Mischung aus Genen und pränatalen Bedingungen in das Gehirn einprogrammiert wird, von denen sich der Fötus nichts aussucht.